10 Artikel
aus Psychologie heute zwischen 1991-99
Psychologie heute:
Hypnose gegen Krebs?
In der Ausgabe Februar '91 der medizinischen
Fachzeitschrift "Psychologie heute" beschreibt Harald Wiesendanger
im Artikel "Hypnose gegen Krebs" neue Hypnoseverfahren und Meditationstechniken
zur Krebsbehandlung. Man fand heraus, daß ein streßfreier Zustand
eine wichtige Voraussetzung sei, um mit Hilfe von Visualisierungen und Imaginationen
das Immunsystem positiv zu beeinflussen. In den Vereinigten Staaten setzte man
Hypnosetherapie seit langem in der psychologischen Krebsbehandlung ein. O. Carl
Simonton und Bernauer Newton bestätigten, daß mit Hypnose therapierte
Krebspatienten eine wesentlich höhere Lebenserwartung haben, als statistisch
angenommen. Neben den USA setzt man inzwischen auch in Deutschland, Großbritannien
und Australien auf Hypnosetherapie bei der Krebsbehandlung: "In Trance
versetzt gelingt es manchem Tumoraptienten, durch Visualisierungen und Imaginationen
bösartige Geschwulste am Weiterwachsen zu hindern, sie sogar zurückzubilden"
- so Wiesendanger.
Im Mittelpunkt des Artikel steht die Knochenkrebsbehandlung
des Krefelder Diplom-Psychologen Dr. Gerhard Susen. Der Autor schildert wie
Susen bei einer 56-jährigen Knochenkrebspatienten den Krebs erfolgreich
besiegen konnte. Nach der Teilremission konnte sogar Chemotherapie und alle
weiteren Medikamente abgesetzt werden. Bis heute ist die Patientin immer noch
frei von krebsverdächtigen Befunden. Susen konnte der Patientin eine neue
Einstellung zu ihrem Körper vermitteln. "In jedem Körper",
so Susen, "ist ein positives und heilendes Prinzip verankert. Das kann
man das Unbewußte nennen oder den 'inneren Freund'. Auch ein Symptom wie
Krebs entspringt nicht der Laune des Organismus, sondern enthält eine Botschaft
... muß irgend einen Nutzen haben, den wir, auch wenn wir ihn nicht erkennen
können, doch anerkennen sollten." Weiterhin betont Susen, daß
der Aufbau einer feindseligen Einstellung zum eigenen Organismus, lanfristig
nutzlos sei."Essentiell" für den Heilungsprozess sei eine positive
Einstellung zu den inneren Prozessen des Körpers. Der Körper, auch
der kranke, müsse als Partner umworben werden, "der Hilfe leistet
und dem man Vertrauen entgegenbringen kann."
Gefühle beeinflussen Immun-Reaktion
Die Psychoneuroimmunologie bestätigt Susens Erkenntnisse.
Das Immunsymstem werde durch begleitende psychische Prozesse stark beeinflusst.
Seelische Belastungen könnten Immunreaktionen unterdrücken und zur
Entstehung von Krankheiten beitragen. Hypnose könne das Immunsystem direkt
und indirekt beeinflussen:
- Indirekt: Angst und Anspannung wird abgebaut, das
Ich gestärkt, postive Vorstellungen erzeugt, die sich psychosomatisch
auswirken könnten.
- Direkt: Hypnotische Suggestionen senken meßbar
den Spiegel der Streßhormone, die die weißen Blutkörperchen
beeinflussten und damit wesentlich zur Körperabsehr beitragen.
Inzwischen kann die Hypnose-Therapie beträchtliche Erfolge
aufweisen. Die Imagination der "machtvollen Heilkräfte" beim
Krieg gegen die Tumore weise eine Erfolgsquote auf, die die Schulmedizin zum
Denken bringen müßte.
Psychologie heute:
"Sie haben Krebs, wissen Sie das?"
 Die
Ausgabe November 1995 der Fachzeitschrift "Psychologie
heute" behandelt ausführlich das Thema Krebsdiagnose-Übermittlung.
Tom Doch diskutiert, wie Ärzte ihren Patienten schwerwiegende Diagnosen
übermitteln. Neben einer Reihe von Beispielen der Brutalübermittlung,
zeigt Doch auf, was bei der Diagnoseübermittlung zu beachten ist und welchen
Stellenwert die Informationsübermittlung für die Krebstherapie hat.
Die
Ausgabe November 1995 der Fachzeitschrift "Psychologie
heute" behandelt ausführlich das Thema Krebsdiagnose-Übermittlung.
Tom Doch diskutiert, wie Ärzte ihren Patienten schwerwiegende Diagnosen
übermitteln. Neben einer Reihe von Beispielen der Brutalübermittlung,
zeigt Doch auf, was bei der Diagnoseübermittlung zu beachten ist und welchen
Stellenwert die Informationsübermittlung für die Krebstherapie hat.
Zu Beginn berichtet der Autor über Brutalübermittlungen
der schlimmsten Form. Zu oft werde der Patient während der Visite mit der
Schreckensbotschaft überrumpelt und mit seinem Schicksal allein gelassen.Viele
Ärzte sind mit ihrer Botenfunktion überfordert und versuchen die Dianoseübermittlung
schnell hinter sich zu bringen. Zu recht urteilt Doch: "Brutalübermittlungen
dieser Art wirken herzlos, kalt und abweisend. (...) Leichtfertig wird die Grenze
zur fahrlässigen Seelen- und Körperverletzung überschritten".
Am schlimmsten sei, daß das Vertrauen in Können und Umsichtigkeit
des Artzes zerstört würde, das von signifikanter Bedeutung für
den Erfolg jeder Therapie sei. Im folgenden schildert Doch die Erfahrung eines
Arztes, der lernt, das es für die Übermittlung der Schreckensbotschaft
auch bessere Wege gebe. Nach der Diagnose-Übermittlung beim Patienten zu
bleiben, abzuwarten und zuzuhören, gäben dem Patient und auch dem
Arzt ein erheblich besseres Gefühl.
Gründe für die unsensible Diagnose-Übermittlung
sei Unsicherheit und mangelnde Kompetenz in Gesprächsführung. Das
Medizinstudium schließe Gesprächsführung und Kommunikationstechniken
nicht mit ein. Die wenigen Seminare, die vereinzelt an Universitäten angeboten
würden, fielen bei den Studenten nur auf geringes Interesse. Hinzu käme,
daß die meisten Ärzte total überlastet seien und im rationalisierten
Praxisbetrieb nur wenig Zeit bliebe für ein einfühlsames Arzt-Patienten-Verhältnis.
Außerdem beklagt der Autor, daß eine Kooperation von Medizin und
Psychologie nicht ausreichend stattfände.
Bei der Übermittlung von schwerwiegenden Dianosen habe
der Arzt folgendes zu beachten:
- kein Zeitdruck bei der Diagnose-Übermittlung
- ehrliches Interesse
- die Bereitschaft zuzuhören
- die Fähigkeit zuzuhören
- völlige Präsenz
- Übermittlung der Wahrheit direkt, sachlich, einfühlsam
und verständnisvoll, jedoch möglichst keine genauen Prognosen.
- Angstpotential des Patienten nicht durch vermeidbare Änste
erhöhen.
Psychologie heute: "Der Patient hat einen Anspruch auf
die Wahrheit"
Psychologie heute rundet das Thema mit einem Gespräch mit
dem Medizinprofessior über die Sprachlosigkeit der Ärzte ab. Professor
Dr. Linus Geisler ist seit 1976 leitender Arzt der Inneren Abteilung am St.
Barbara-Hospital in Gladbeck. Er ist Autor des Buches "Arzt und Patient
- Begegnung im Gespräch (Pharma-Verlag, Frankfurt). Das Gespräch mit
Professor Geisler führte Tom Doch.
Geisler sieht das Problem der katastrophalen Dianose-Übermittlungen
in der Tendenz, daß durch dir Hightech-Medizin der Wert der Kommunikation
in den Hintergrund gerückt sei. Dabei sei das Wort immer noch das wichtigste
Instrument des Arztes. Er verbringe 70 bis 80 Prozent seiner Arbeitszeit sprechend.
Ein weiteres Problem sei, daß der Arzt "den Kopf voll" habe.
Er müsse die Diagnose richtig übermitteln, die Aufklärungs-Gepflogenheiten
und juristischen Modalitäten beachten. Die eigenen Ängste des Arztes
machen den Moment der Diagnose-Übermittlung zu einem Kanossagang.
Geisler weist darauf hin, daß die Diagnose immer schon
ein Teil der Therapie sei. Fände der Arzt in den ersten 10, 20 Sekunden
eines solchen Gesprächs nicht die richtigen Worte, stehe die Therapie von
Anfang an unter einem schlechten Stern. Schon Goethe habe gesagt: "Wer
das erste Knopfloch verfehlt, wird beim Zuknöpfen immer Probleme haben."
Da die Wahrheitsübermittlung beim Patienten immer mit Assoziazionen verbunden
sei, müsse das individuelle Vorwissen des Patienten miteinbezogen werden.
Geisler betont, daß Wahrheitsübermittlung ein prozeßhaftes
Geschehen sei und keinesfall mit der Betätigung eines Kippschalters zu
tun habe. Aus diesem Grund müsse man besonders SANFT und mit viel EINFÜHLUNGSVERMÖGEN
vorgehen. Auch wenn der Patient Anspruch auf die Wahrheit habe, müsse die
Phasen der Verdrängung beim Patienten respektiert werden. "Niemand
kann lange in die Sonne der Wahrheit sehen" - so Geisler. Sigmund Freund,
der ein Kieferkarzinom hatte, soll zum behandelnden Arzt gesagt haben: "Mit
welchem Recht sagen Sie mir die Wahrheit"?
Psychologie heute: "Die
Schulmedizin muß bewußter mit dem Prinzip Hoffnung umgehen"
 In
der Ausgabe Mai 1996 berichtet die Zeitschrift Psychologie
heute über ein Gespräch mit dem Onkologen Gerwin Kaiser, Sprecher
der Arbeitsgruppe Biologische Krebstherapie der Deutschen Krebshilfe in dem
er Stellung bezieht über unkonventionelle Krebstherapien und die zukünftige
Entwicklung der Schulmedizin. Kaiser betont, daß alternative Behandlungsformen
bei Krebs auf keinen Fall Alternativen zu den bewährten Verfahren der Schulmedizin
seien. Es fehlten fundierte Nachweise der vermeintlichen Heilerfolge und eine
genaue Untersuchung der Nebenwirkungen. Der große Teil der Krebskranken,
der diese Methoden in Anspruch nähme, stelle nicht die objektive Wirksamkeit
in den Vordergrund, sondern suche vor allem einen verständnisvollen Therapeuten,
der hilfreich zur Seite stehe. Dennoch könnten auch alternative Verfahren
"indirekt" Wirkung zeigen, da sie bei psychischen Bewältigung
der Krankheit unterstützten.
In
der Ausgabe Mai 1996 berichtet die Zeitschrift Psychologie
heute über ein Gespräch mit dem Onkologen Gerwin Kaiser, Sprecher
der Arbeitsgruppe Biologische Krebstherapie der Deutschen Krebshilfe in dem
er Stellung bezieht über unkonventionelle Krebstherapien und die zukünftige
Entwicklung der Schulmedizin. Kaiser betont, daß alternative Behandlungsformen
bei Krebs auf keinen Fall Alternativen zu den bewährten Verfahren der Schulmedizin
seien. Es fehlten fundierte Nachweise der vermeintlichen Heilerfolge und eine
genaue Untersuchung der Nebenwirkungen. Der große Teil der Krebskranken,
der diese Methoden in Anspruch nähme, stelle nicht die objektive Wirksamkeit
in den Vordergrund, sondern suche vor allem einen verständnisvollen Therapeuten,
der hilfreich zur Seite stehe. Dennoch könnten auch alternative Verfahren
"indirekt" Wirkung zeigen, da sie bei psychischen Bewältigung
der Krankheit unterstützten.
Auf der Suche nach einer Lösung gegen den Krebs, habe man
vermehrt nach Vorkommen von sekundären Pflanzenstoffen mit krebsbekämpfender
Wirkung geforscht. Die "phytochemische Feinarbeit" der Forscher würde
durch die Tatsache erschwert, daß es etwa fünf- bis zehntausend bioaktiver
Substanzen gäbe, deren additive oder synergetische Wirkung noch unerforscht
sei. Einige Studien belegten hingegen, daß Phytochemikalien "richtige
Lebensmittel" und gesunde Ernährung nicht ersetzten. Der amerikanische
Gesundheitswissenschaftler Paul Rosch betont, daß es unmöglich sei,
"ein der Natur gleichwertiges Phyto-Konzentrat" industriell herzustellen.
"Im Klartext: Bei Phyto-Pillen handelt es sich um Mogelpackungen.",
so Watzl und Leitzmann.
Der renommierten amerikanische Ernährungswissenschaftler
T. Colin Campbell von der Cornell Universität geht davon aus, daß
etwa 80 bis 90 Prozent der gesamten Herz- und Krebserkrankungen vermieden werden
könnten, wenn die Menschen eine höhere Priorität auf gesunde
Ernährung setzten. "Undere Ernährungsweise ist ein Killer",
meint Cambell. Er weist außerdem darauf hin, daß zwischen Intelligenz,
Genuß und Gesundheit eine Verbindung bestehe, allerdings nur bei der Gabe
natürlicher Lebensmittel.
Kaisers Arbeitsgruppe sei bei Bewertung alternativer Verfahren
vor allem auf methodische Schwierigkeiten gestoßen. Überwiegend fehlten
ausreichende fachwissenschaftliche Informationen. Denoch versuchte man die Frage
nach der Wirksamkeit im Interesse aller Krebskranken genau zu überprüfen
und solche unkonventionellen Verfahren zu entdecken, die möglicherweise
weiter entwickelt werden könnten. Die nach Kaiser eher "unsicheren
Kandidaten", die mit unerfüllbaren Erfolgsverheißungen, Krebspatienten
gefährdeten, versuche man herauszufiltern.
Jeder Onkologe sei zu einem verantwortungsvollen Umgang mit
dem Prinzip Hoffnung aufgerufen und sollte nach Kaiser auch die Vielfalt unkonventioneller
Verfahren sowie Ernährung, körperliche Bewegung, Sexualität,
psychische und soziale Hilfe in das Behandlungskonzept miteinzubeziehen. Die
Schulmedizin müsse lernen bewußter und differenzierter mit dem therapeutischen
"Prinzip Hoffnung" im Sinne von menchlicher Wärme und Hoffnung
umzugehen.
Psychologie heute: Psychoonkologie:
Therapie, weil die Seele leidet
Sabine Fritsch hebt in ihrem Artikel "Therapie, weil die
Seele leidet?" (Psychologie heute, Ausgabe Februar 1997)
die Bedeutung der psychosozialen Unterstützung bei Krebspatienten hervor.
Weltweit gehe man davon aus, daß Krebs multifaktorielle Ursachen vor allem
im Bereich der Psychoneuroimmunologie (PNI) hat. Für den Wiener Psychoonkologen
und Psychiater Walter König, Begründer der Österreichischen Gesellschaft
für somatische und psychosomatische Onkologie, seien Ärzte und Patienten
bei Krebs mit Ängsten, Hilflosigkeiten und Depressionen konfrontiert. Um
den schwierigen Umgang mit Krebskranken zu verbessern, hält König
professionelle Team- und Einzelsupervisionen auf Krebsstationen ebenso notwendig
wie ein umfassendes Gesprächs- und Kommunikationstraining für den
Arzt. 40 bis 50 % aller Krebspatienten leideten an psychischen Beschwerden,
schweren Persönlichkeits- und Anststörungen; jeder zehnte leide unter
Depressionen.
Generell, so der Nürzberger Krebs-Mediziner Ortwin Kaiser,
sollte jeder krebsbehandelnde Arzt auch unkonventionelle Verfahren in sein Behandlungskonzept
einschließen. Die Bedeutung sogenannter "weicher Faktoren" wie
Ernährung, körperliche Bewegung, Sexualität und psychische und
soziale Unterstützung sei nicht zu unterschätzen. Bei einer Großstudie
des Psychoonkologen Thomas Küchler im Auftrag des Bundesministeriums für
Forschung am Hamburger Universitätskrankenhaus wurden diese Zusammenhänge
bestätigt. Die psychozialbetreute Kontrollgruppe überlebte die nur
medizinisch behandelte Kontrollgruppe um genau 101 Tage.
Psychologie heute: Onkologie:
Die Bedeutung eines "krebsgesunden Lebens"
In der Ausgabe Februar 1997 der medizinischen
Fachzeitschrift "Psychologie heute" geht Andreas Huber (Redaktion)
auf die Bedeutung der Prävention bei der Krebsbekämpfung ein. Krebs
sei die zweithäufigste Todesursache in Deutschland und man müsse in
den nächsten 15 Jahren mit einer Verdoppelung der Krebserkrankungen rechnen.
Allerdings könne die Schulmedizin nahezu 45% der jährlich 300.000
an Krebs erkrankten Menschen mit naturwissenschaftlichen Methoden wie Chirurgie,
Strahlen- und Chemotherapie heilen. Auf der anderen Seite könne man mit
der modernen Gentherapie weder Menschen heilen noch behandeln - so die Krebsmedizinerin
Maren Killmann. Auch der renommierte Harward-Mediziner Walter Willett räumt
ein, daß man trotz aller Forschung der "Hochleistungsonkologie"
mit der Krebsforschung immer noch am Anfang stehe. Man wisse zu wenig über
die genauen Hintergründe der Krebsentstehung.
Aus diesem Grund müsse der Vorbeugung und einem "krebsgesunden"
Lebensstil wesentlich höhere Bedeutung beigemessen werden. Nicht umsonst
verabschiedete die EU einen "europäischen Kodex zur Krebsbekämpfung".
Die meisten Erwachsenen hätten ein sehr großes Interesse an der Krebsprävention.
Generell sei in der Bevölkerung ein hohes Maß an Gesundheitsbewußtsein.
Der "soziale Faktor" bei der Krebsbekämpfung
werden hingegen vollkommen unterschätzt. Zu unrecht!
- Bei einer amerikanischen Studie in den 80er Jahren mit 30
000 Krebsfällen fand man heraus, daß soziale Unterstützung
und partner- oder freundschaftliche Zuwendung den Krebs beeinflusse: unverheiratete
oder allein lebende Menschen hatten deutlich schlechtere Überlebenschancen.
- Ähnliches Ergebnis bei einer Gruppe von Leukämiepatienten:
Während bei der weniger beziehungsgestützten Kontrollgruppe nicht
einmal jeder Fünfte überlebte, überlebten von den Patienten
, die durch eine Knochenmarktransplantation behandelt und durch Ehepartner,
Verwandte und Freude emotional gestützt wurden, mehr als die Hälfte.
- Bei den meisten Spontanremissionen spiele die "heilende
Kraft gelingender zwischenmenschlicher Beziehungen" eine entscheidende
Rolle.
- Auch Professor Walter Gallmeier, Präsident der Bayrischen
Krebsgesellschaft, erkennt die Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen
als wesentlicher Faktor im Heilungsprozeß.
- Eine niederländische Langzeitstudie mit 20.000 Frauen
und Männern der Medizinerin Inez Young von der Universität Rotterdam
bestätigt diese Erkenntnisse: Verheiratete oder in fester Beziehung lebende
Personen seien im Vergleich weniger suizidgefährdet, erkrankten seltener
an Leberzirrhosen und seien deutlich weniger anfällig für Krebserkrankungen.
Trotz dieser eindrucksvollen Erkenntnisse sei die "soziale
Frage" bei der Krebsbekämpfung immer noch zu wenig erfoscht. Der Medizinpsychologe
Joachim Kepplinger hebt hervor: Man wisse zuwenig über die Strukturen und
innere Differenzierung der Paarbeziehung bei der Krankheitverarbeitung.
 Psychologie
heute: "Psychologische Heilungsphantasien sind eben nur das: Phantasien"
Psychologie
heute: "Psychologische Heilungsphantasien sind eben nur das: Phantasien"
 |
| Reinhold Schwarz,
Facharzt für Psychotherapeutische Medizin, Soziologe und Psychoanalytiker,
ist in Heidelberg ärztlicher Leiter des Psychosozialen Nachsorgezentrums
für Tumorpatienten; viele Publikationen zum Thema, darunter "Die
Krebspersönlichkeit" (Schattauer-Verlag, Stuttgart 1994)
|
Die Ausgabe Februar 1997 der medizinischen
Fachzeitschrift "Psychologie heute" veröffentlicht ein Gespräch
mit dem Krebsmediziner Reinhold Schwarz, in dem er Stellung bezieht über
alternative Krebsheilungen, die "Krebspersönlichkeit" und die
Bedeutung der Psychoonkologie.
Schwarz sieht die psychotherapeutinsche Begleitung von Krebspatienten
absolut für notwendig. Jedoch könnten seiner Meinung nach alternative
Krebsheilmethoden keinesfalls "alternativ", sondern nur komplementär
eingesetzt werden. Die Neue Medizin nach Dr. Hamer sei für Krebspatienten
extrem gefährlich, wie der spektakuläre Fall des krebskranken Mädchens
gezeigt habe.
Die sogenannte "Krebspersönlichkeit" der Psychoonkologie
sei eine klare Fehleinschätzung - so Schwarz. Den "depressiven Typ
C", für den das Krebsrisiko besonders hoch sei, gäbe es nicht.
"Die Depressivität hat nichts mit dem Tumor zu tun - sondern mit der
Furcht davor", meint Schwarz. Das "Typ-C-Verhalten" im Sinne
gelernter Hilflosigkeit und belasteter Kindheitsereignisse könnte keiner
empirischen Überprüfung standhalten. Ein Krankheitsbild könne
nicht mit einem bestimmten Persönlichkeitsmuster verknüpft werden,
wenn die Ursachen dieser Krankheit unklar seien.
Weiterhin spricht sich Schwarz klar gegen das DHS (Dirk-Hamer-Syndrom)
aus. Krebsauslöser könne keinesfalls ein schrechliches Ereignis in
der Vergangenheit sein. Diese "Überlastungstheorie" schließe
nur seelische Krankheitsursachen mit ein; Schwarz hingegen plädiert für
ein mulikausales Verständnis.
Schwarz räumt ein, daß es psychosomatische Faktoren
gebe, die Krebs fördern (z. B. Risikoverhalten, langandauernde Überlastung
und chronische psychosomatisch mitbedingte Erkrankungen), jedoch seien Streß
und seelische Überlastung und Erschöpfung nur unspezifische Krankheitsfaktoren."Bei
der Diagnose Krebs hingegen sind zunächst gravierende psychische Folgen
wesentlich", meint Schwarz.
Auf der anderen Seite könne "die Bedeutung der Psychoonkologie
für die Betreuung krebskranker Menschen und ihrer Angehörigen nicht
hoch genug eingeschätzt werden", so Schwarz. Dennoch: Die Psychoonkologen
müßten sicht bewußt sein, daß ihr Angebot in Kooperation
mit der medizinischen Therapie erfolgen muß - und psychologische
Heilungsphantasien als Phantasien und nicht als Realität anzusehen seien.
| |
| Hermann Faller, Mediziner und promovierter Psychologe,
ist Oberarzt am Institut für Psychotherapie und Medizinische Psychologie
der Universität Würzburg. Seine klinischen Erfahrungen in der
Betreuung krebskranker Menschen und als psychoonkologischer Forscher werden
in dem demnächst erscheinenden Buch "Krankheitsverarbeitung bei
Krebskranken" (Hogrefe-Verlag, Göttingen) beschrieben. |
Psychologie heute: "Der
Krebskranke darf auch mal depressiv und traurig sein"
Die Ausgabe April 1998 der medizinischen Fachzeitschrift 'Psychologie
heute' berichtet über ein Gespräch mit dem Psychoonkologen Herrmann
Faller. Im Schwerpunkt äußert sich Faller zu den Themen "fighting
spirit" - dem wahren Kampfgeist gegen Krebs - und den Stand der psychologischen
Krebsforschung. Faller betrachtet die psychologische Komponente der Krebsforschung
eher skeptisch. Die "aktive, kämpferische Einstellung gegenüber
der Krebserkrankung - der Fighting spirit -" könne zwar den Krankheitsverlauf
positiv beeinflussen, jedoch müsse dies nicht notwendigerweise so sein.
Auch die emprischen Forschungsergebnisse zur sogenannten "Krebspersönlichkeit"
seien eher "inkonsistent". Es spreche vieles dafür, daß
"die unter dem Stichwort "Krebspersönlichkeit" beschriebenen
Phänomene eher eine Reaktion auf die Krebsdiagnose darstellen, statt seine
Ursache zu sein." - meint Faller. Man müsse Gefühle und Seelenleben
des Patienten immer ernst nehmen und für eine besondere psychologische
Unterstütztung bei der Krankheitsbewältigung sorgen. Der Kranke müsse
selbst herausfinden, welche Form der Krankheitsverarbeitung angemessen sei.
Zusätzliche alternative Behandlungsformen, gäben dem Kranken das Gefühl
selbst etwas zu tun und förderten eine aktive Bewältigungsstrategie.
Es sei besonders wichtig, daß man dem Kranken vermittelte, daß er
auch traurig und depressiv sein dürfe und das zum Verarbeitungsprozeß
dazugehöre.
Die psychologische Forschung weise gravierende Mängel auf.
Neben widersprüchlichen Befunden, zeigen methodische Probleme zumindest,
daß man Ergebnisse eher vorsichtig interpretiere und man an der Qualität
der Forschung arbeite. Dennoch: Bewiesen sei daß "aktives Coping
im Sinne eines Fighting Spirit" die Überlebenszeit bei Lungenkrebskranken
verlängere, während emotionale Belastung und Depressivität die
Lebenszeit verkürze. Der Fighting spirit erhöhte demnach die immunologische
besonders wichtigen Killerzellen.
Trotz dieser Indizien sei es nicht ausgeschlossen, "daß
die psychologische Faktoren lediglich Indikatoren des körperlichen Zustandes
sind - und nicht umgekehrt die körperliche Befindlichkeit direkt beeinflussen"
- so Faller. Nur durch langfristige, sogenannte "prospektive Interventionsstudien",
könnten die kausalen Effekte einer Veränderung der Krankheitsbewältigung
präzise überprüft werden. In jedem Fall müßte für
Krebskranke spezielle psychotherapeutische Behandlungsprogramme entwickelt werden,
die viel konkreteren Maße in der Akutmedizin und in der Rehabilitation
eingesetzt werden sollten.
Psychologie heute: Kann
man Krebs doch wirksam vorbeugen - und heilen?
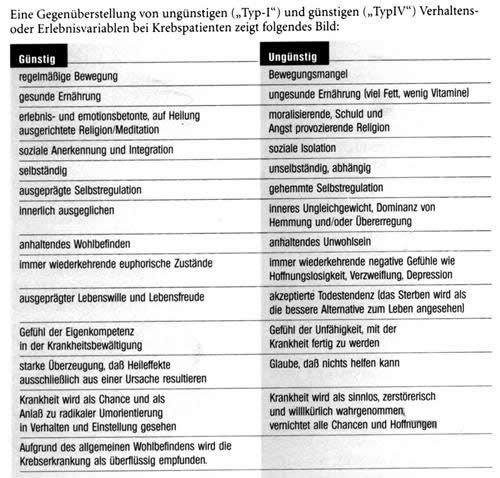 In
der Ausgabe Mai 1998 der medizinischen Fachzeitschrift 'Psychologie heute' werden
mit Blick auf das Gesamtumfeld der Psychoonkologie die psychologischen Einflüsse
bei Krebskranken diskutiert. Allein in den USA wurden in den letzten 20 Jahren
mehr als 25 Milliarden Dollar in die Krebsforschung investiert. Nicht ganz ohne
Erfolg, meint der Autor. Einige Krebsarten hätten durch radiologische,
chemotherapeutische oder chirurgische Verfahren gute Heilungschancen. Auch in
der molekulargenetischen Forschung sei man ein gutes Stück weiter gekommen.
Weiterhin hätten die Erkenntnisse der Psychoneuroimmunologie den Zusammenhang
zwischen Immunsystem und seelischen, körperlichen und psychosozialen Einflüssen
erwiesen. Vor dem Hintergrund der Kompexität der beteiligten Prozesse,
sei es wichtig, einen besonderen Schwerpunkt auf die systemische Psychosomatik
zu legen. Für das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Psyche
und Körper sei der Begriff "Synergetik" wesentlich. Während
"Synergetik" ein "Zusammenwirken" bezeichnete, sei "Synergie"
nicht nur ein addieren, sondern auch potenzieren der relevanten Faktoren.
In
der Ausgabe Mai 1998 der medizinischen Fachzeitschrift 'Psychologie heute' werden
mit Blick auf das Gesamtumfeld der Psychoonkologie die psychologischen Einflüsse
bei Krebskranken diskutiert. Allein in den USA wurden in den letzten 20 Jahren
mehr als 25 Milliarden Dollar in die Krebsforschung investiert. Nicht ganz ohne
Erfolg, meint der Autor. Einige Krebsarten hätten durch radiologische,
chemotherapeutische oder chirurgische Verfahren gute Heilungschancen. Auch in
der molekulargenetischen Forschung sei man ein gutes Stück weiter gekommen.
Weiterhin hätten die Erkenntnisse der Psychoneuroimmunologie den Zusammenhang
zwischen Immunsystem und seelischen, körperlichen und psychosozialen Einflüssen
erwiesen. Vor dem Hintergrund der Kompexität der beteiligten Prozesse,
sei es wichtig, einen besonderen Schwerpunkt auf die systemische Psychosomatik
zu legen. Für das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Psyche
und Körper sei der Begriff "Synergetik" wesentlich. Während
"Synergetik" ein "Zusammenwirken" bezeichnete, sei "Synergie"
nicht nur ein addieren, sondern auch potenzieren der relevanten Faktoren.
Zweiter essentieller Schlüsselbegriff der systematischen
Psychoonkologie ist die Selbstregulation - auch "Selbstorganisation"
und "Autopoiese". Aus systemischer Sicht könne Heilung immer
nur Selbstheilung im Sinne von Deblockierung der Selbstregulation sein. Was
für die Synergetik von Risikofaktoren gelte, stimme auch für die förderlichen
oder "salutogenen" Heilfaktoren. Auch bei Ihnen könne es zu einer
potenzierten Wirkung kommen. So beruhten Spontanremessionen auf psychisch salutogenen
Aspekten wie "Überlebenswillen, Orientierung an Lust und Wohlergehen,
Sinnfindung in nahen Beziehungen und einer sich mit Lebensfreude und Lebenszuversicht
verbindenden, oft auch religiös fundierten Gelassenheit." - meint
Huber (Redaktion).
Im Rahmen der Heidelberger Krebsstudien sei die Rolle der Selbstregulation
und salutogener Faktoren bei Krebs ausführlich untersucht worden. Bei eingeschränkter
Selbstregulation falle die Mortalität bei krebskranken Männer und
Frauen gleich aus. Jedoch bei optimaler Selbstregulation, falle die Überlebensrate
bei beiden Kontrollgruppen deutlich höher aus.
Kern der Heidelberger Krebsstudien ist die sogenannte Krebspersönlichkeit.
Danach lassen sich Menschen in bestimmte Typen einordnen (s. Tabelle). Typ 1
sei deutlich anfäller für Krebs als Typ IV, der die höchste Überlebensrate
aufweise.
Um derartige Verhaltensweisen und Einstellungen vorzubeugen,
versucht die prospektive Interventionsstrategie, fehlende Verhaltensweisen zu
trainieren.Grossarth-Marticek untersuchte in einem Versuchsprojekt den Einfluß
unterschiedlicher Interventionsmaßnahmen auf die Krebspersönlichkeit.
Zwei Kontrollgruppen mit gleicher Risikoanfälligkeit wurden unterschiedlichen
Behandlungsmethoden ausgesetzt. Eine Kontrollgruppe erhielt, falls notwenig,
konventionelle medizinische Behandlung, die andere Kontrollgruppe wurde mit
unterschiedlichen Interventionsmaßnahmen konfrontiert: Ernährungsberatung,
Raucherentwöhnung, Multivitamingaben, etc. Als die wirksamste Interventionsmaßnahme
stellte sich das "Autonomietraining" heraus. Dabei sollte Selbstregulation
soweit wie möglich "trainiert" werden. Es zeigte sich, daß
man durch ein gezieltes "Autonomietraining", die Krebserkrankung in
vielen Fallen eindämmen konnte. Das "Autonomietraining" zeigte
deutlich höhere Wirksamkeit als andere Interventionsmaßnahmen. Die
Heidelberger prospektiven Studien belegen, daß durch "Autonomietraining"
die Überlebenschance bei Krebs sich um ein Vielfaches erhöhte:
- Nach 20 Jahren waren von der "Autonomietrainings"-Kontrollgruppe
noch 60 Prozent gesund, von der andere Kontrollgruppe, die nicht trainiert
wurde, blieben nur 3,3 Prozent gesund.
- Nach 15 Jahren hatten fast 80 Prozent der Personen überlebt,
die nach Ausbruch der Krebserkrankung ein Autonomietraining mitgemacht hatten.
- 80 Prozent der "trainierten" Brustkrebspatientinnen
überlebten.
Das "Autonomie"-Training zielte lediglich darauf ab,
die Lernfähigkeit im psychisch-sozialen Bereich zu "trainieren".
Dabei ginge mam von den gleichen Prinzipien aus wie die der systemischen Therapien.
Die systematische Psychoonkologie sehe das Krebsleiden und eine blockierte Selbstheilung
(wie Typ I) als Ausdruck und Folge einer geschwächten Selbstregulation.
Einzel- und systemische Therapien gäben einen "Tiefenblick" in
die seelischen und beziehungsbezogenen Faktoren, die bei einer Krebserkrankung
beteiligt sein könnten. Im wesentlichen unterscheide man zwei problematische
Szenarien:
- Beim ersten Szenarium mangele es generell an Beziehungen,
die die Basis für einen zwischenmenschlichen Austausch und damit eine
gelingende Selbstregulation überhaupt bewirken könnten. Ein Teil
dieser Gruppe neige aus Ersatzbefriedigung zu extrem selbstschädigendem
Verhalten.
- Beim zweiten Szenarium komme zu einer sich verstrickend auswirkenden
und häufig mit Hemmung einhergehenden Bindung. Aufgrund dieser Verstrickung
werde oftmals das Wissen einer gesundheitsbewußten Lebensweise nicht
in die Praxis umgesetzt.
In den Therapien des Heidelberger Teams werden Auswege aus diesen
Zwickmühlen gefunden. Vor allem lerne man darauf zu achten, was einem wirklich
guttue. Durch dieses Training könne es in vielen Fällen sehr schnell
zu einem sprunghaften Wandel kommen, einem "discontinuous change".
Durch den Anstoß eines Elements in einem komplex vernetzten Systems veränderten
sich auch alle anderen Elemente. Konsequenz: "Aus einem negativen Zirkel
und Teufelskreis kann so ein positiver, selbstheilender Prozeß entstehen."
- berichtet Huber.
Psychologie heute: "Wir
können mehr gegen Krebs tun, als man annnimmt"
| |
| Helm Stierlin, Jahrgang 1926, war von 1974 bos 1991
Ärztlicher Direktor der Abteilung für Psychoanalytische Grundlagenforschung
und Familientherapie der Universität Heidelberg; mehrere Professuren
und Gastdozenturen an amerikanischen Universitäten sowie in Australien
und Neuseeland. Er ist einer der Gründungsväter der Familien-
und systemischen Therapie im deutschsprachigen Raum; Gründer der Zeitschrift
"Familiendynamik"; sein bisherisges Lebenserk umfaßt fast
200 wissenschaftliche Arbeiten, seine 12 Bücher würden in 10 Sprachen
übersetzt. |
In der Ausgabe Mai 1998 berichtet 'Psychologie heute' über
ein Gespräch mit Helm Stierlin, daß Andreas Hube mi Frühjahr
1998 mit dem Wissenschaftler geführt hatte. Stierlin äußert
sich über die Durchbrüche in der Psychoonkologie und die Heidelberger
Krebsstudien. Obwohl Stierlin die Kritik an der sogenannten Krebspersönlichkiet
teile, hält er an den beiden Verhaltenstypen - Typ I und Typ IV - fest.
Typ I sei gekennzeichnet durch einen Zustand des "Sich-nicht-Wohlfühlens
voller Hoffnungslosigkeit". Das Hauptmißverständnis liege darin,
den Begriff der Krebspersönlichkeit als "naturgegeben" und "unveränderbar"
zu verstehen. Verhaltensmuster könnten verändert werden und daduch
das persönlichkeitsbestimmende schöpferische, gesunde Potential eines
Menschen wieder ins Leben gerufen werden. Mal solle daher nicht von "Krebspersönlichkeit",
sondern von einer "Krebsmentalität" sprechen.
Ein wesentlichen Problem, daß Krebspatienten belaste,
sei die Schuldfrage. In das Konzept der Krebspersönlichkeit paßt
die Annahme, daß man den Krebs aufgrund eines bestimmten persönlichen
Wesensmerkmals selbst verursacht habe. Die Belastung mit dieser Schuld könne
sich sehr "destruktiv" auswirken. " Krebspatienten sollen sich
also nicht von ihrer Persönlichkeit befreien, sondern von der krankmachenden
Schuldlast. Das einzige, für das sie sinnvoll Verantwortung übernehmen
können, ist, sich zukünftig um ihr Wohlbefinden zu kümmern, so
gut es geht." - folgert Stierlin.
Auf die Frage von Huber, wie er zu den Angriffen an seinem Koautor
und Datenlieferant Grossarth-Marticek stehe, meint Stierlin, daß die Studien
seines Kollegen zwar umstritten seien, aber die Begutachtung 300 Fachwissenschaftlern
bestanden hätten. Hans-Jürgen Eysencks beurteilt die Arbeit sehr positiv:
"Die prospektiven Studien von Grossarth-Maticek und seinen Mitarbeitern
zählen zu den am besten kontrollierten und überprüften in der
Welt." Stierlin wirft ein, daß die tiefsitzenden Grundannahmen der
Studien die Grundannahmen der Wissenschaft ins Wanken brächten. Stierlin
spricht von "einer Revolution im Umgang mit Gesundheit und Krankheit",
da dem psychologischen Foktor eine niedagewesene zentrale Bedeutung zugewisen
würde. Im Sinne der Krebskranken hoffte, daß die Etablierung des
Konzepts der prospektiven Studien trotzt des Gegenwind schnell voranschreite.
Jeder sollte die Freiheit haben, seine (gesundheitliche) Situation zu verändern.
Jede noch so verzwickte "Zwickmühle" könne therapeutisch
schnell aufgelöst werden und damit Gesundungsprozesse und neue Lebensenergien
freigesetzt werden. Ärzte und Therapeuten müßten sich im Sinne
der Heidelberger Studien weiterbilden, da "auch für das Gesundheitswesen
geben sich weitreichende Folgen, da immense Behandlungskosen eingespart werden
könnten." - so Stierlin.
Das "Autonomietraining", daß innerhalb der Heidelberger
Studien zur Veränderung der Verhaltensmuster eingesetzt würde, sei
eine "flexibel gehandhabte Kurztherapie", die "durch verschiedene
therapeutische Techniken, Anstöße zur Verhaltensänderung"
vermittelte und "ganz auf die individuelle Bedürfnis- und Ressourcenlage"
zugeschnitten sei. Das Training in Form von Einzelgesprächen und/oder Einzelsitzungen
sei "zukunfts-, lösungs- und ressourenorientiert. Ziel sei, eine Eigeninitiative
einzuleiten und dem Patienten auf Dauer Wohlbefinden zu verschaffen. Denn: "Wohlbefinden
läßt sich gleichsam als Motor, Ausdruck und Folge einer gelingenden
Selbstregulation verstehen." - so Stierlin. Eine Blockierung des Sich-zum-Ausdruckbringens
bewirke eine Grundgefühl des Unwohlsein. Folge: ein Zustand stiller Verzweiflung,
nach dem amerikanischen Therapeut Le Shan die "bottle-up"-Energie,
die Menschen krank mache. Durch eine verbesserte Selbstregulation blühte
das Individuum auf und verfüge über beste Heilungschancen.
Grossarth-Maticeks Studien seien trotz psychoonkologischer Ausrichtung
in einem systemischen Blickwinkel zu betrachten. Die Studien basierten auf dem
Konzept der "Selbstorganisation und Selbstregulation, die in unserem Jahrhundert
die biologischen Wissenschaften und in den letzten Jahren die systemische Therapie
revolutioniert haben" - argumentiert Stierlin. Die prospektiven Studien
seien "systemisch" ausgerichtet, da man der Bedeutung der "Synergie
- eine potenzierendes, systemisches Zusammenwirken von Risikofaktoren"
und auch dem Kausalverständis eines "rückgekoppelten, "vernetzten"
Prozesses" einen hohen Stellenwert zuweise und in die Studien integriere.
Nach Stierlin sei "systemisch (...) eine existentielle, lebensweltlich
orientierte Dimension, da es darauf ankommt, Wohlbefinden als Ausdruck und Folge
der Selbstregulation zu sehen." Wohlbefinden in Stierlins Sinne beschränke
sich nicht allein auf "puren Hedonismus", sondern bringe auch etwas
"Sinnvolles in die Welt". Je mehr Lebensfreude man ausstrahle, desto
mehr würden andere Menschen dazu übergehen sich aus "Ichzentriertheit
und Selbstabschottung" zu befreien.
Beim Gesundungsprozeß des Krebskranken solle die Familie
nicht überbewertet werden. Der familiäre Rückhalt sei wichtig,
jedoch hänge Heilung davon ab, wie aktiv der Krebskranke versucht, Konflikte
in den jeweiligen Beziehungssystemen zu lösen. Stierlin mißt einem
gesunden Konfliktmangement sehr große Bedeutung zu: "Konflikte gehören
zum Prozeß einer gesunden Entwicklung, die ich als bezogene Individuation
beschrieben und erforscht habe. Systemisch orientierte Therapeuten und Berater
können bei solch heilendem Konfliktmanagement eine große Hilfe sein."
Kernfrage bei der Suche einer Therapieform sollte sein: "Wieweit
helfen mir diese Personen, damit ich meine Selbstregulation und mein Wohlbefinden
tatsächlich fördern kann?"
Psychologie heute: Krebs
- Macht und Ohnmacht der Psychologen
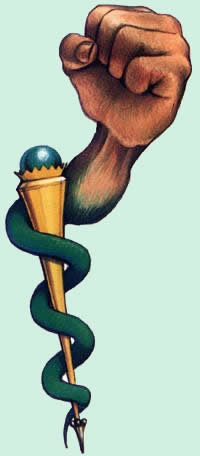 In
der Ausgabe November 1998 der Fachzeitschrift 'Psychologie heute' diskutiert
Claudia Schmidt-Rathjens die "Heidelberger Krebsstudien" des Heidelberger
Vielforschers Professor Dr. Dr. Ronald Grossarth-Maticek, Direktor des von ihm
gegründeten ECPC, des "Europäischen Zentrums für Frieden
und Entwicklung", und des dortigen "Instituts für präventive
Medizin". Grossarth-Marticeks Theorie beruht auf den Erkenntnissen von
Hippokrates und Galen, die melancholisches Verhalten als typischen Persönlichkeitsmuster
für Krebserkrankungen einstuften.
In
der Ausgabe November 1998 der Fachzeitschrift 'Psychologie heute' diskutiert
Claudia Schmidt-Rathjens die "Heidelberger Krebsstudien" des Heidelberger
Vielforschers Professor Dr. Dr. Ronald Grossarth-Maticek, Direktor des von ihm
gegründeten ECPC, des "Europäischen Zentrums für Frieden
und Entwicklung", und des dortigen "Instituts für präventive
Medizin". Grossarth-Marticeks Theorie beruht auf den Erkenntnissen von
Hippokrates und Galen, die melancholisches Verhalten als typischen Persönlichkeitsmuster
für Krebserkrankungen einstuften.
Grossarth-Marticek hat in den "Heidelberger Krebsstudien" folgende
Verhaltenstypologie herausgearbeitet:
| Typ
1: "Hemmung der ichbezogenen Expression" |
Typ
4: "gesunde Selbstregulation" |
- neurotische Tendenz
- eigenes Wohlbefinden
ist davon abhängig, unselbständige, abhängige emotionale
Nähe zu geliebten Personen oder Erfolg zu bedeutsamen Tätigkeiten
zu erlangen
- "Versagertyp"
|
- ist fähig, Verhalten,
Ziele und Grundannahmen auf der Basis von kommunikativem Feedback, Einsicht
und Reflexion zu korrigieren
- diese Fähigkeit
ist verknüpft mit Wohlbefinden und Gesundheit
|
| Fazit:
Gesundheit und Krankheit sind nicht
schicksalshaft biologisch vorgegeben. Gesundheit ist die Folge eines bestimmten
Verhaltensmusters - und als solches lernbar. |
Grossarth-Maticek hat seine Studie mit Co-Autorenschaft zahlreicher renommierter
Wissenschaftler untermauert. Dennoch wird die Studie starkt angefochten. Sie
zahlreiche theoretische und methodische Unzulänglichkeiten, Unklarheiten
der Datenerhebung und -analyse und unterschiedliche Publikationen seien inkonsistent
dokumentiert. Außerdem ist nicht geklärt ob:
- eine stärkere Ausprägung des Typ-1-Verhaltensmusters
sowie
- eine geringe Ausprägung des Typ-4-Verhaltensmusters
unterscheiden.
Die Autorin stellt an dieser Stelle drei mögliche Forschungmethoden
vor, um diese Frage empirisch prüfen zu können.
| 1.
Querschnittliche, retrospektive Studien
Personen mit einer bereits
diagnostizierten Krebserkrankung werden hinsichtlich psychosozialer Variablen
verglichen mit einer oder mehreren Kontrollgruppen ohne "malignen"
Befund.
Vorsicht: Unklar bleibt,
ob Gruppenunterschiede vor Krankheitsbeginn ("prämorbid")
oder als Folge der Erkrankung auftraten ("krankheitsreaktiv").
Problem: schwierige Interpretation |
| 2.
Längsschnittliche, prospektive Studien
Große Stichprobe von
gesunden Personen. Nach einem längeren Zeitraum werden die jeweiligen
Persönlichkeitsmerkmale der zwischenzeitlich Krebserkrankten mit
denjenigen der gesund gebliebenen Personen verglichen.
Vorsicht: Hoher Zeit- und
Kostenaufwand |
| 3.
Quasi-Prospektive Studien
Kompromiß zwischen Quer- und Langsschnittstudien:
Risikogruppe mit einem krebsverdächtigen Befund (etwa einem Knoten
in der Brust) wird vor der entscheidenden diagnostischebn Maßnahme
auf psychosoziale Mermale untersucht. Nach der Diagnosebestellung können
Personen mit benignem ("gutartigem") und malignem Befund verglichen
werden.
Vorsicht: Vermutung der Patienten bezüglich
der Diagnose ("Antizipation der Diagnose") muß unbedingt
miterhoben werden. |
Zur Überprüfung der "Heidelberger Studien"
wurde am Psychologischen Institut der Universität Heidelberg ein Forschungprojekt
mit insgesamt 721 Patienten der Universitätsfrauenklinik sowie der Thorxklinik
Heidelberg durchgeführt. Untersucht wurde, ob sich Persönlichkeitsmerkmale
tatsächlich von Patienten mit beligner von solchen mit maligner Erkrankung
unterschieden. Ergebnis: Keine einzige der psychologischen Variablen erwies
sich als geeignet zwischen benignen und malignen Erkrankungen zu trennen. Mit
dem Erkrankungrisiko korrelierte lediglich das Alter. Fazit: Je älter die
Patienten sind, desto größer ist das Risiko einer Krebserkrankung.
Die Autorin warnt davor den Einfluß psychischer Prozesse
bei Krebserkrankungen zu überschätzen. Eine kranke Persönlichkeit
sei nicht immer mit Krebs verknüpft, vielmehr werde die Persönlichkeit
durch die Diagnose Krebs krank.
Psychologie heute: Krebs - Die Ängste ernster
nehmen!
Barbara Geisler diskutiert in ihrem Artikel "Die Ängste
ernster nehmen!" der Zeitschrift "Psychologie heute" (Ausgabe
April 1999) das Thema Angst bei Krebs. In Deutschland seien zwischen 25 und
59 Prozent der Tumorpatienten psychologisch behandlungsbedürftig. 23 Prozent
der krebskranken Menschen leideten unter klinisch bedeutsamen Ängsten.
Barbara Geisler bezieht sich im folgenden auf eine Krebsstudie
von Peter Herschbach, Psychologe von der Poliklinik für Psychosomatische
Medizin, Psychotherapie und Medinische Psychologie der Technischen Universität
München. Herschbach fand heraus, daß Tumorpatienten weniger von Schmerzen
(69 Prozent) geplagt werden als von Angst vor dem Fortschreiten ihrer Erkrankung
(80 Prozent). Bei dreiviertel der Krebskranken trete Angst vor Hilflosigkeit
oder Siechtum, Ängste vor dem Tod, Unruhe und innere Anspannung besonders
in der Phase der Diagnosestellung auf. Im fortgeschritteten Krebsstadium entwickelten
sich vermehrt Depressionen.Vor allem das veränderte Körperbild belastete
Brustkrebspatientinnen und Patienten mit Tumoren im Kopf-Hals-Bereich. Bei Gesichts-
bzw. Hauttumoren suchten Frauen um ein Drittel häufiger eine psychoonkologische
Beratung auf als männliche Krebskranke.
Krebsforscher Herschbach kritisiert den sogenannten ICD-10 (International
Classifikation of Deseases). Es sei fragwürdig, daß Therapeuten und
Ärzte den seelischen Zustand ihrer Patienten in ein Kategoriesystem für
psychisch und seelisch Kranke, einstuften. Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft
für Psychoonkologie (DAPO) habe ein weiteres Kategoriesystem erarbeitet,
um die seelischen Zustände speziell für Krebskranke zu erfassen. Ziel
sei, anhand eines Schlüssel - eine Art ICD für Krebskranke - für
jeden Krebskranken die richtige Interventionsmaßnahme herauszuarbeiten.
Nach Herschbach kümmerten sich die onkologischen Kliniken zu wenig um die
Nachbehandlung von Krebspatienten. Krebskranke hätten jedoch gerade nach
ihrer Behandlung Angst vor neuen Tumorbildungen oder Rückfällen. Diese
"Progredienzangst" schränke die Lebensqualität vieler Krebspatienten
stark ein. Herrschbachs genau zugeschnittenes Angstbewältigungstrainingstprojekt
wird vom Bundesforschungsministerium und der Rentenversicherung finanziert.
 Die
Ausgabe November 1995 der Fachzeitschrift "Psychologie
heute" behandelt ausführlich das Thema Krebsdiagnose-Übermittlung.
Tom Doch diskutiert, wie Ärzte ihren Patienten schwerwiegende Diagnosen
übermitteln. Neben einer Reihe von Beispielen der Brutalübermittlung,
zeigt Doch auf, was bei der Diagnoseübermittlung zu beachten ist und welchen
Stellenwert die Informationsübermittlung für die Krebstherapie hat.
Die
Ausgabe November 1995 der Fachzeitschrift "Psychologie
heute" behandelt ausführlich das Thema Krebsdiagnose-Übermittlung.
Tom Doch diskutiert, wie Ärzte ihren Patienten schwerwiegende Diagnosen
übermitteln. Neben einer Reihe von Beispielen der Brutalübermittlung,
zeigt Doch auf, was bei der Diagnoseübermittlung zu beachten ist und welchen
Stellenwert die Informationsübermittlung für die Krebstherapie hat. In
der Ausgabe Mai 1996 berichtet die Zeitschrift Psychologie
heute über ein Gespräch mit dem Onkologen Gerwin Kaiser, Sprecher
der Arbeitsgruppe Biologische Krebstherapie der Deutschen Krebshilfe in dem
er Stellung bezieht über unkonventionelle Krebstherapien und die zukünftige
Entwicklung der Schulmedizin. Kaiser betont, daß alternative Behandlungsformen
bei Krebs auf keinen Fall Alternativen zu den bewährten Verfahren der Schulmedizin
seien. Es fehlten fundierte Nachweise der vermeintlichen Heilerfolge und eine
genaue Untersuchung der Nebenwirkungen. Der große Teil der Krebskranken,
der diese Methoden in Anspruch nähme, stelle nicht die objektive Wirksamkeit
in den Vordergrund, sondern suche vor allem einen verständnisvollen Therapeuten,
der hilfreich zur Seite stehe. Dennoch könnten auch alternative Verfahren
"indirekt" Wirkung zeigen, da sie bei psychischen Bewältigung
der Krankheit unterstützten.
In
der Ausgabe Mai 1996 berichtet die Zeitschrift Psychologie
heute über ein Gespräch mit dem Onkologen Gerwin Kaiser, Sprecher
der Arbeitsgruppe Biologische Krebstherapie der Deutschen Krebshilfe in dem
er Stellung bezieht über unkonventionelle Krebstherapien und die zukünftige
Entwicklung der Schulmedizin. Kaiser betont, daß alternative Behandlungsformen
bei Krebs auf keinen Fall Alternativen zu den bewährten Verfahren der Schulmedizin
seien. Es fehlten fundierte Nachweise der vermeintlichen Heilerfolge und eine
genaue Untersuchung der Nebenwirkungen. Der große Teil der Krebskranken,
der diese Methoden in Anspruch nähme, stelle nicht die objektive Wirksamkeit
in den Vordergrund, sondern suche vor allem einen verständnisvollen Therapeuten,
der hilfreich zur Seite stehe. Dennoch könnten auch alternative Verfahren
"indirekt" Wirkung zeigen, da sie bei psychischen Bewältigung
der Krankheit unterstützten. Psychologie
heute: "Psychologische Heilungsphantasien sind eben nur das: Phantasien"
Psychologie
heute: "Psychologische Heilungsphantasien sind eben nur das: Phantasien"

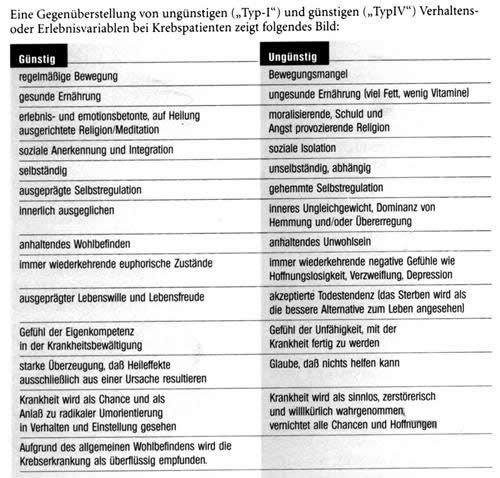 In
der Ausgabe Mai 1998 der medizinischen Fachzeitschrift 'Psychologie heute' werden
mit Blick auf das Gesamtumfeld der Psychoonkologie die psychologischen Einflüsse
bei Krebskranken diskutiert. Allein in den USA wurden in den letzten 20 Jahren
mehr als 25 Milliarden Dollar in die Krebsforschung investiert. Nicht ganz ohne
Erfolg, meint der Autor. Einige Krebsarten hätten durch radiologische,
chemotherapeutische oder chirurgische Verfahren gute Heilungschancen. Auch in
der molekulargenetischen Forschung sei man ein gutes Stück weiter gekommen.
Weiterhin hätten die Erkenntnisse der Psychoneuroimmunologie den Zusammenhang
zwischen Immunsystem und seelischen, körperlichen und psychosozialen Einflüssen
erwiesen. Vor dem Hintergrund der Kompexität der beteiligten Prozesse,
sei es wichtig, einen besonderen Schwerpunkt auf die systemische Psychosomatik
zu legen. Für das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Psyche
und Körper sei der Begriff "Synergetik" wesentlich. Während
"Synergetik" ein "Zusammenwirken" bezeichnete, sei "Synergie"
nicht nur ein addieren, sondern auch potenzieren der relevanten Faktoren.
In
der Ausgabe Mai 1998 der medizinischen Fachzeitschrift 'Psychologie heute' werden
mit Blick auf das Gesamtumfeld der Psychoonkologie die psychologischen Einflüsse
bei Krebskranken diskutiert. Allein in den USA wurden in den letzten 20 Jahren
mehr als 25 Milliarden Dollar in die Krebsforschung investiert. Nicht ganz ohne
Erfolg, meint der Autor. Einige Krebsarten hätten durch radiologische,
chemotherapeutische oder chirurgische Verfahren gute Heilungschancen. Auch in
der molekulargenetischen Forschung sei man ein gutes Stück weiter gekommen.
Weiterhin hätten die Erkenntnisse der Psychoneuroimmunologie den Zusammenhang
zwischen Immunsystem und seelischen, körperlichen und psychosozialen Einflüssen
erwiesen. Vor dem Hintergrund der Kompexität der beteiligten Prozesse,
sei es wichtig, einen besonderen Schwerpunkt auf die systemische Psychosomatik
zu legen. Für das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Psyche
und Körper sei der Begriff "Synergetik" wesentlich. Während
"Synergetik" ein "Zusammenwirken" bezeichnete, sei "Synergie"
nicht nur ein addieren, sondern auch potenzieren der relevanten Faktoren.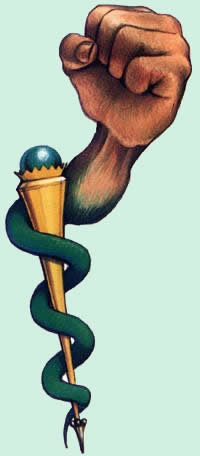 In
der Ausgabe November 1998 der Fachzeitschrift 'Psychologie heute' diskutiert
Claudia Schmidt-Rathjens die "Heidelberger Krebsstudien" des Heidelberger
Vielforschers Professor Dr. Dr. Ronald Grossarth-Maticek, Direktor des von ihm
gegründeten ECPC, des "Europäischen Zentrums für Frieden
und Entwicklung", und des dortigen "Instituts für präventive
Medizin". Grossarth-Marticeks Theorie beruht auf den Erkenntnissen von
Hippokrates und Galen, die melancholisches Verhalten als typischen Persönlichkeitsmuster
für Krebserkrankungen einstuften.
In
der Ausgabe November 1998 der Fachzeitschrift 'Psychologie heute' diskutiert
Claudia Schmidt-Rathjens die "Heidelberger Krebsstudien" des Heidelberger
Vielforschers Professor Dr. Dr. Ronald Grossarth-Maticek, Direktor des von ihm
gegründeten ECPC, des "Europäischen Zentrums für Frieden
und Entwicklung", und des dortigen "Instituts für präventive
Medizin". Grossarth-Marticeks Theorie beruht auf den Erkenntnissen von
Hippokrates und Galen, die melancholisches Verhalten als typischen Persönlichkeitsmuster
für Krebserkrankungen einstuften.